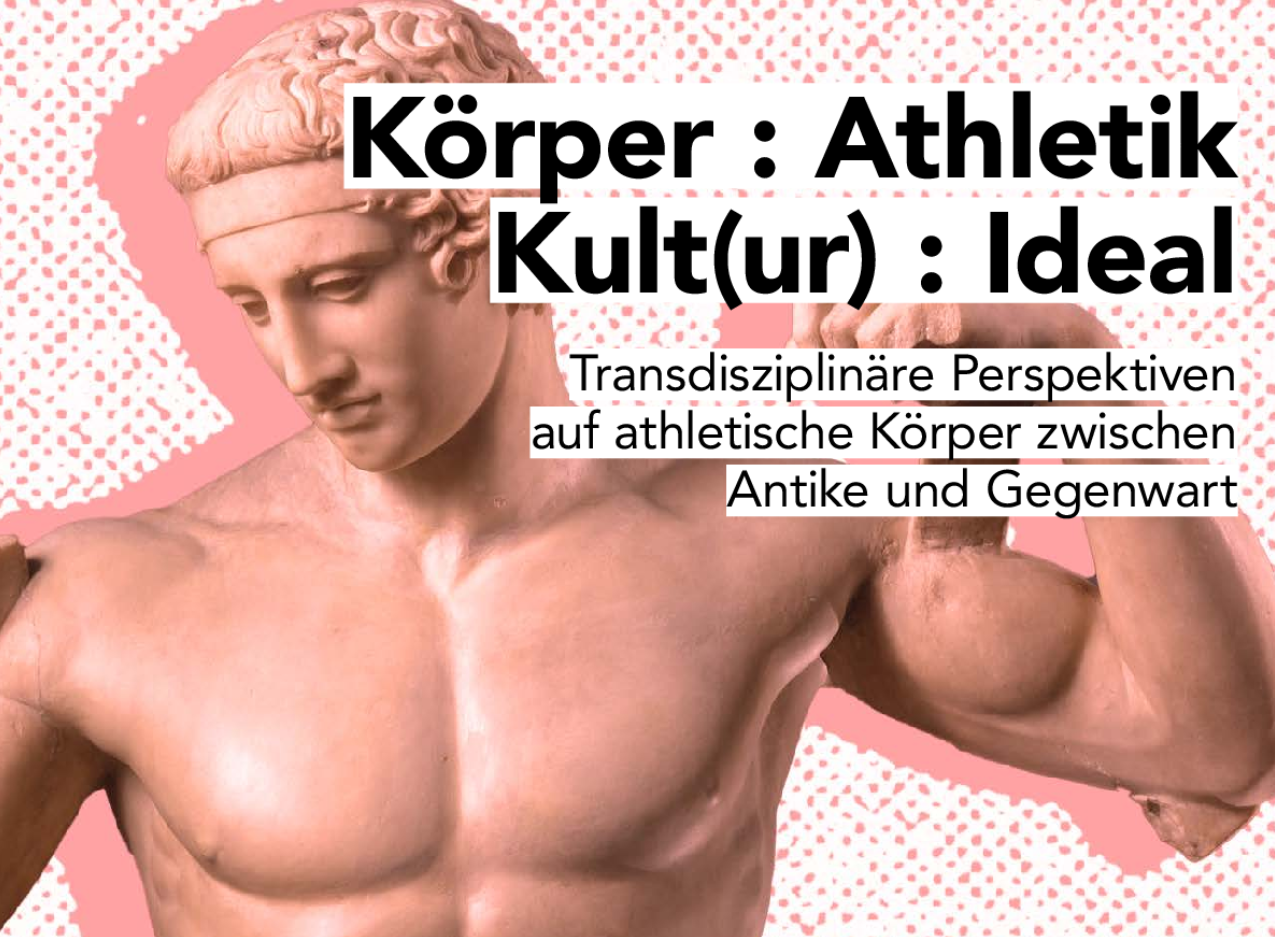Inhaltliche Ausrichtung
Im Alltagsverständnis und der Populärwissenschaft ist das Bild der römisch-griechischen Antike eng an Körperlichkeit und Sport geknüpft und wird dabei als Archetyp oder auch als Gegenbild konstruiert. Der antike Sport ist folglich mitunter mannigfaltig durch moderne Ideologien und die neuzeitliche Sportentwicklung illusorisch besetzt. Während sich die (altertumswissenschaftliche) Forschung von ideologisierenden Interessen, einseitigen Kodifizierungen und typisierenden Funktionalisierungen emanzipiert hat und kritisch mit der Wissenschafts- und Mentalitätsgeschichte zum antiken Sport auseinandergesetzt hat, zeigen sich in anderen gesellschaftlichen Bereichen diese eigentlich überwundenen Konzepte bis heute besonders persistent. Rezeption umfasst dabei nicht die schlichte Übernahme präfigurierter Konzepte, sondern stets auch ein Mitschwingen handlungsleitender und moralisierender Ideologien zur Stiftung von Legitimation oder Nobilität.
Die Tagung zielt daher darauf, inter- und transdisziplinäre Perspektiven auf vergangene und heutige erinnerungskulturelle Dynamiken einzunehmen, bei denen der athletische Körper zum Dreh- und Angelpunkt wird. In vier Schwerpunkten wird sich mit der antiken Körper- und Bewegungskultur in ihren vielfältigen kulturellen, religiösen, politischen und sozialen Bedeutungen beschäftigt. Dabei werden (vermeintlich) antike Reartikulationen in aktuellen Gesellschaftsfeldern und Wissenschaftsdisziplinen erarbeitet und reflektiert.
Letztlich werden auch einige besonders virulente Tagungsfragen im Rahmen eines begleitenden URBI-Science-Talks verhandelt, bei der in einer Podiumsdiskussion Wissenschaftler:innen mit einer breiteren Öffentlichkeit bzw. Praktiker:innen ins Gespräch kommen. Dafür werden ein:e Sportpädagog:in, ein:e Altertumswissenschaftler:in, ein:e Praktiker:in, ein:e Sportler:in mit Behinderung und zwei Studierende gemeinsam ein publikumsoffenes Podium bekleiden.